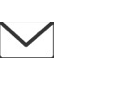Den Geschichten der Opfer näherkommen

Vorsichtig blättert Celina durch eine dicke Akte mit vergilbten Seiten: „Das sind so alte Dokumente, da hat man Angst, etwas kaputtzumachen“, sagt die Elftklässlerin. Wie alle aus ihrer Stufe ist sie für zwei Tage vom Unterricht am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT) freigestellt, um eines der sechs Projekte ihrer Schule für den Holocaust-Gedenktag vorzubereiten. Ihre Entscheidung für die Recherche im Stadtarchiv hat die Schülerin bewusst getroffen: „Das Thema ist am nächsten an uns dran, weil es um Leute geht, die hier in Trier gelebt haben.“
Simone Fugger von dem Rech, Leiterin des Stadtarchivs, freut sich, dass junge Menschen im Zuge des Projekts ihren Weg in das Archiv an der Weberbach gefunden haben. In der direkten Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS-Opfer sieht sie eine Chance, das Demokratieverständnis der Jugendlichen zu stärken: „Die Tendenzen, Menschen auszugrenzen, gibt es immer noch. Deshalb müssen wir immer wieder aufzeigen, wie schnell wir wieder in solche gesellschaftlichen Abgründe abdriften können.“
Auch Kulturdezernent Markus Nöhl, der die 14 Schülerinnen und Schüler vor Ort begrüßte, betonte die Wichtigkeit solcher Projekte: „Man kann die menschlichen Schicksale und das Leid nur ermessen, wenn man wegkommt von den Zahlen.“ Dafür sei das Archiv genau der richtige Ort.
Das Projekt entstand aus einer gemeinsamen Idee von Dr. Sonja Benner, die am HGT Geschichte unterrichtet, und René Richtscheid vom Emil-Frank-Institut. „Wir machen die Erfahrung, dass außerschulische Partner unglaublich kooperativ sind“, lobt Benner die Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. „Inhaltlich ist es für uns Lehrkräfte kein Mehraufwand. Das Problem ist höchstens, dass durch die Stundenpläne alles immer sehr eng getaktet ist“, erklärt die Lehrerin. Ziel des Projektes ist, die Jugendlichen für die Aktualität des Themas Antisemitismus zu sensibilisieren. Gleichzeitig werden die Opfer der NS-Diktatur gewürdigt, indem die Menschen hinter den bloßen Zahlen einen Teil ihrer Identität zurückerhalten.
Genau das ist auch die Absicht, die Kunsthistoriker Ralf Kotschka mit dem luxemburgisch-deutschen Bündnis „Grenzenlos gedenken“ hegt. Zu ihm hatte Projektleiterin Benner Kontakt aufgenommen, um ihre Idee in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft umzusetzen. Die Namen der 513 Menschen, die im Oktober 1941 in einem ersten Deportationszug von Luxemburg über Trier in das Ghetto Litzmannstadt verschleppt wurden, hat die AG bereits zusammengetragen. Um aber die einzelnen Schicksale der Deportierten erzählen zu können, ist das Bündnis auf die Mithilfe von Schülergruppen wie der aus dem Humboldt-Gymnasium angewiesen.
Dankbar und mit viel Ernsthaftigkeit nehmen die 14 Jugendlichen das Lernangebot an diesem besonderen Ort an: „Wir arbeiten hier viel selbstständiger. Man hat einfach mehr Möglichkeiten und vor allem mehr Zeit, sich einmal richtig in ein Thema einzuarbeiten“ beschreibt Fabian den Unterschied zum normalen Schulunterricht. Und tatsächlich fügt sich das Puzzle für die recherchierenden Jugendlichen immer weiter zusammen. Am selben Tisch blättert Fabians Mitschüler Juri durch ein Buch mit Stammbäumen. „Je weiter man sich in diese Dokumente vertieft, desto mehr erfährt man über das Leben dieser Menschen“, erzählt der Elftklässler.
Das Material, mit dem die Schülerinnen und Schüler arbeiten, wurde von den Mitarbeitenden des Stadtarchivs ausgewählt und bereitgestellt. So habe das Archiv einiges an Vorarbeit geleistet, erläutert Fugger. Ihr Wunsch ist, dass Projekte dieser Art künftig öfter in den Räumen an der Weberbach stattfinden: „Lehrer können auf uns zukommen und das Archiv als außerschulischen Lernort nutzen“, wirbt die Archivleiterin. Für den 23. Februar plant sie mit ihren Mitarbeitenden eine Infoveranstaltung für Lehrkräfte, damit die papierenen Zeitzeugen künftig häufiger in die Hände junger Menschen kommen.
Von Helena Belke