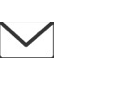Patienten offen für Neues

RaZ: Warum haben Sie Ihre Stelle als Kardiologie-Chefärztin am Brüderkrankenhaus aufgegeben und sich selbständig gemacht?
Dr. Enise Lauterbach: Im Frühjahr 2018 bin ich vom Brüderkrankenhaus in das Zentrum für Ambulante Rehabilitation (ZAR) gewechselt und habe eine ambulante kardiologische Reha etabliert. Aus vielfältigen Nachfragen meiner Patienten entstand initial die Idee einer App für Patienten mit Herzschwäche. Der Wunsch nach der besten medizinischen Behandlung ist aktueller denn je. Angst vor der Digitalisierung haben Patienten keine. Sie vertrauen Ärzten, die ihr analoges Können beherrschen. Somit komme ich dem Appell meiner Patienten nach, für sie Medizin zu digitalisieren. Die Idee für eine Messenger-App kam mir, als ich täglich mindestens eine Stunde Befunden hinterher telefoniert habe. Diese Zeit hätte ich besser für Patienten nutzen können.
Hatten Sie vorher schon unternehmerische Erfahrungen?
Nein. Ich bin Schulmedizinerin und Ärztin mit ganzem Herzen. Der Schritt aus der klinischen Tätigkeit ist mir nicht leicht gefallen.
Warum haben Sie sich für den Einstieg im Trierer Digital Hub entschieden?
Der Digital Hub kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte auch schon selbst die Idee für einen Hub gehabt, einen Knotenpunkt, an dem verschiedene Akteure gemeinsam agieren können. Dann war ich sehr erfreut, zu hören, dass die städtische Wirtschaftsförderung dort schon innovativ tätig ist. Da war es logisch, dass ich in den Hub einsteige.
Was erhoffen Sie sich davon?
Ich erhoffe mir unter anderem, dass dabei verschiedene Partner in einem Boot sitzen. Das können IT-Firmen sein, Krankenhäuser, Krankenkassen und die beiden Trierer Hochschulen, die schon einige Angebote für Gesundheitsberufe im Angebot haben. Diese Akteure brennen dafür, dass es weitergeht mit der Digitalisierung.
Gab es schon ein Feedback auf Ihr Konzept, auch nach der Auszeichnung mit dem Innovationspreis der IHK?
Eine Menge, wobei ich dabei schon von vorneherein nach Kooperationspartnern gesucht habe. Dabei wollte ich auch möglichst früh erfahren, wie mein Konzept angenommen wird. Die Resonanz war wahnsinnig positiv.
Wie ist die von Ihnen entwickelte App mit der elektronischen Gesundheitsakte vereinbar, auf der viele Patientendaten und Befunde zentral gesammelt werden, um Abläufe zu vereinfachen?
Mit der Gesundheitsreform 2004 hat der Gesetzgeber die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) beschlossen. Damals habe ich mein letztes Staatsexamen gemacht, wurde Ärztin und habe mich gefreut, dass es endlich voran geht und Patienten nicht mehr 100 Mal die gleichen Angaben machen müssen und dann auch mal etwas Wichtiges, wie Grunderkrankungen oder Allergien vergessen. Aber es hat sich aus verschiedenen Gründen sehr stark verzögert. Wenn alles gut geht, wird die elektronische Gesundheitsakte 2021 flächendeckend eingeführt. Ich sehe für meine ergänzenden Produkte gute Chancen auf dem sehr komplexen Gesundheitsmarkt, der anders ist als andere Branchen. Es geht immer um Patienten, nicht um Kunden. Die jetzige Versorgungssituation rechtfertigt Anwendungen, wie ich sie entwickelt habe. In Deutschland sollten wir handeln, weil die europäischen Nachbarn viel weiter sind als wir. Österreich und die nordischen Länder haben schon eine digitale Patientenakte. Wir müssen hier nicht alles neu erfinden.
Worin sehen Sie den besonderen Nutzen ihres Ärzte-Messengers?
Es gibt schon Messenger-Apps für Ärzte. Ich glaube aber, dass sie nicht ganz unsere Bedürfnisse befriedigen. Ich will die Kommunikation zwischen den Medizinern, die sich schon sehr verändert hat, weiter optimieren. Die Vision von „Consil!um" ist eine schnelle, sichere und unkomplizierte Kommunikation zwischen Ärzten.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Davon profitieren Ärzte oder kleinere Kliniken, die ihre Patienten an das Herzzentrum im Brüderkrankenhaus überweisen wollen. Derzeit geschieht das oft immer noch per Fax oder Brief und dauert entsprechend lange. Manchmal muss es aber sehr schnell gehen. Die Verbindung per Messenger-App funktioniert sehr einfach. Der Arzt hat gleich die Befunde zur Hand und kann sie direkt mitschicken.
Wie wollen Sie den Datenschutz sicherstellen?
Es gibt eine End-to-End-Verschlüsselung. Die Daten werden nicht auf einer Cloud irgendwo im Ausland abgelegt, sondern auf einem speziellen Server, für den strenge Standards der Datensicherung gelten. Das muss immer das oberste Prinzip sein, weil Patientendaten besonders sensibel sind. Die Datensicherung der App hat hohe ethische Standards.
In welcher Phase befindet sich Ihr Projekt?
Ich habe einen Kooperationspartner in der Region gefunden. Wenn alles gut klappt, können wir Mitte Dezember loslegen. Die Testphase ist definitiv abgeschlossen. Die Messenger-App ist kein Prototyp mehr, sondern ein fertig ausgereiftes Projekt. Aber eine Software wird auch immer ständig weiterentwickelt, nach den Bedürfnissen der Kollegen. Ich kann auf individuelle Wünsche eingehen.
Wie soll die Messenger-App finanziert werden?
Die Krankenhäuser können sie abonnieren. Die genaue Summe richtet sich nach der Größe der Kliniken. Bei niedergelassenen Ärzten soll das auch möglich sein, die Beträge werden aber deutlich niedriger sein. Später soll man den Messenger auch in den App-Stores runterladen können. Im Moment setze ich vor allem auf die Vermarktung vor Ort in Trier. Da man sich in der Gesundheitswirtschaft gut kennt, bin ich offen für eine gemeinsame Weiterentwicklung dieses Pilotprojekts.
Wie sieht es mit einer Nutzung des Messengers durch Patienten aus?
Es gab schon sehr viele Anfragen, aber im Moment muss das erst noch zurückstehen. Wenn das Angebot für die Ärzte gut läuft, wollen wir später eine Patientenakte anbieten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, egal ob alt oder jung, sehr offen für solche Veränderungen sind.
Haben Sie weitere Projekte in Ihrem Portfolio?
Mein eigentliches Hauptprojekt ist „Herz-Held" für Patienten mit Herzschwäche. Das ist quasi ein tragbares Frühwarnsystem mit Überwachung aller Funktionen, um Lücken in der Behandlung zu schließen. Der Patient wird ständig überwacht und Vitalparameter, wie Blutdruck und Gewicht, sind über eine Smartwatch oder ein Smartphone verfügbar. Einmal am Tag erhält er eine Nachricht, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Dann kann er sich an den (Not)-Arzt oder die Klinik wenden. Die Erinnerung ist sehr wichtig, weil Patienten schon mal nachlässig werden, wenn es ihnen gut geht. Dann vernachlässigen sie zum Beispiel die Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr. Die Technologien für die neuen Anwendungen sind da, ich bin quasi die Ärztin, die analoge Behandlungen in digitale umbettet. Der Bedarf ist sehr groß. In Deutschland haben wir rund 2,5 Millionen Menschen mit Herzinsuffizienz. Wird ihnen schnell und effizient geholfen, ist das auch ein Beitrag zur Kostensenkung.
Haben Sie neben der medizinischen auch eine IT-Ausbildung?
Nein, ich habe einen Software-Ingenieur gefunden, mit dem ich gemeinsam an den Algorithmen schreibe. Ich habe in der Schule Programmieren gelernt und teste heute manchmal einige Anwendungen mit meinen Kindern. Zudem ist der Arbeitsalltag der Kardiologen stark digital geprägt, zum Beispiel mit dreidimensionalen Untersuchungsverfahren.
Wir waren Ihre Erfahrungen bei dem Start-up-Camp der Wirtschaftsförderung im Mai?
Das war sehr spannend, mit einer sehr offenen Atmosphäre und der Bereitschaft für Neuentwicklungen. Es ging nicht nur um Digitalisierung, sondern auch um eine gemeinsame Entwicklung von Konzepten sowie Netzwerke.
Wie bewerten, Sie, Frau Luxem, als Chefin der Wirtschaftsförderung, die Projekte von Frau Lauterbach?
Christiane Luxem: Es ist ein Riesen-Glücksfall, dass sie bei unserem Hub einsteigt. Sie ist ein Paradebeispiel, wie jemand, der schon sehr viel Know-how hat, den Mut hat neue Wege zu gehen. Dafür braucht man aber Zeit. Das ist im Berufsalltag als Kardiologin nicht zu schaffen. So ergab sich der Weg zu dem Start-up. Erfreulicherweise hat Frau Lauterbach nicht nur eine, sondern ganz viele Ideen. Wir hoffen, dass wir sie auf diesem Weg unterstützen, aber auch die Idee des Digital Hub weitertragen und für den Standort Trier etwas Neues schaffen können.
Enise Lauterbach: Wir haben in diesem Bereich in Rheinland-Pfalz einen Nachholbedarf. Andere Bundesländer tun teilweise deutlich mehr für die Digitalisierung. Das habe ich gemerkt, als ich mich zur Vorbereitung meines Projekts bundesweit umgeschaut habe. Wir haben noch Schnittstellenprobleme. Ein Ausbau der Förderung ist mein größter Wunsch.
Das Gespräch führte Petra Lohse