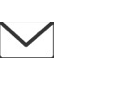18.01.2011
Kaum sprachliche Hürden
Der 58-jährige Dr. Mark Indig wurde in Rumänien geboren und wuchs in den USA auf. Seit rund 30 Jahren lebt er in Trier und betreibt seit 18 Jahren eine Praxis für Urologie und Naturheilverfahren. Vor dem Hintergrund dieser langjährigen Erfahrung und seines Engagements im Beirat für Migration und Integration zieht er im Interview mit der Rathaus Zeitung (RaZ) eine Zwischenbilanz zur gesundheitlichen Versorgung der in Trier lebenden Flüchtlinge und Migranten.
RaZ: Gibt es nach Ihrer Erfahrung häufiger Sprachprobleme bei der alltäglichen Behandlung von Migranten in Trier?
Indig: Das passiert selten. Meistens kommen von vorneherein professionelle Dolmetscher mit oder Angehörige, die besser Deutsch sprechen. Oft klappt auch die nonverbale Verständigung sehr gut, gerade bei Kindern. Manchmal gibt es Unterstützung von Mitarbeitern des Caritas-Verbands, die die Bewohner der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Trier betreuen. Die Zusammenarbeit mit dieser Einrichtung, die auch die medizinische Versorgung erkrankter Asylbewerber koordiniert, funktioniert insgesamt gut.
Gibt es Erkenntnisse, dass die unsicherere wirtschaftliche und aufenthaltsrechtliche Situation mancher Flüchtlinge ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten und psychische Probleme darstellt?
Auf jeden Fall. Patienten kommen in unsere Praxis mit verschiedenen Beschwerden, wie Nierenproblemen. Diese haben häufig psychosomatische Ursachen. Oft kommt es auch zu verstärkten Herz-Kreislaufbeschwerden. Manche Patienten suchen mich mit Krankheiten wie einer kaputten Niere auf, die ihren Ursprung oft noch im jeweiligen Herkunftsland haben. In Deutschland gibt es viel bessere Behandlungsmöglichkeiten, allein schon durch die hochwertigere Ausstattung. Es kommt aber vor, dass mich die Asylbewerber-Aufnahmestelle bittet, dass diese Patienten nicht in einem Trierer Krankenhaus operiert werden, weil in ihrem Gebäude die Bedingungen für eine postoperative Behandlung nicht optimal sind. Dann schicken wir die Kranken nach Ludwigshafen, wo es dafür bessere Möglichkeiten gibt. Insgesamt haben die psychosomatischen Probleme der Flüchtlinge in den letzten Jahren zugenommen.
War diese Entwicklung ein Motiv für Ihr Engagement im Beirat für Migration und Integration?
Ja. Dadurch kann ich meine vielfältigen Kontakte und Erfahrungen nutzen und im Kleinen einiges bewirken. In den Gesprächen mit der Aufnahmeeinrichtung werden meine Empfehlungen oft respektiert und so weit wie möglich ausgeführt. Ich habe als Beiratsmitglied in der Arbeitsgruppe Gesundheit an der Erstellung des Integrationskonzepts mitgewirkt. Aufklärung, Vorsorge und Prävention, zum Beispiel durch Sport, sind mir insgesamt besonders wichtig.
Wie stellt sich die gesundheitliche Situation von Migranten der zweiten und dritten Generation nach Ihrer Einschätzung dar?
Auch hier gibt es eine Häufung psychosomatischer Erkrankungen. Identitätskonflikte in einem Leben zwischen dem Heimatland und dem Alltag in Deutschland gibt es vor allem bei Migranten aus Nahost-Staaten und der ehemaligen Sowjetunion. Sie trauen oft nicht den Diagnosen deutscher Ärzte, nur weil die Behandlung anscheinend nichts kostet und sie lieber dem Arzt aus der alten Heimat vertrauen. Anders verhält es sich bei Patienten aus weiteren Staaten Osteuropas, wie Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen oder Tschechien. Sie sind oft sehr dankbar, überhaupt zum Arzt gehen zu können und wissen das deutsche Gesundheitssystem sehr zu schätzen. Patienten aus anderen EU-Staaten sind ebenfalls meist sehr unkompliziert.
Gibt es Probleme oder Hürden bei der Untersuchung und Behandlung von Frauen, die zum Beispiel mit religiösen Vorstellungen im Islam zusammenhängen?
Das kommt sehr, sehr selten vor, weil den Frauen vorher die Grundlagen erklärt wurden, wie sie sich beim Arzt verhalten müssen. Manchmal kommt auch eine Begleitung zum Arztgespräch mit, aber nicht zur Untersuchung selbst. Ich habe es in meiner beruflichen Praxis nur einmal vor 25 Jahren erlebt, dass auf Intervention des Vaters die Behandlung eines türkischen Mädchens abgebrochen wurde. Vermutlich ist der religiöse Fanatismus in Metropolen wie Berlin grö-ßer als in Trier. Ein Frau mit Burka habe ich in meiner Praxis noch nicht erlebt.
Das Gespräch führte Petra Lohse
RaZ: Gibt es nach Ihrer Erfahrung häufiger Sprachprobleme bei der alltäglichen Behandlung von Migranten in Trier?
Indig: Das passiert selten. Meistens kommen von vorneherein professionelle Dolmetscher mit oder Angehörige, die besser Deutsch sprechen. Oft klappt auch die nonverbale Verständigung sehr gut, gerade bei Kindern. Manchmal gibt es Unterstützung von Mitarbeitern des Caritas-Verbands, die die Bewohner der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Trier betreuen. Die Zusammenarbeit mit dieser Einrichtung, die auch die medizinische Versorgung erkrankter Asylbewerber koordiniert, funktioniert insgesamt gut.
Gibt es Erkenntnisse, dass die unsicherere wirtschaftliche und aufenthaltsrechtliche Situation mancher Flüchtlinge ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten und psychische Probleme darstellt?
Auf jeden Fall. Patienten kommen in unsere Praxis mit verschiedenen Beschwerden, wie Nierenproblemen. Diese haben häufig psychosomatische Ursachen. Oft kommt es auch zu verstärkten Herz-Kreislaufbeschwerden. Manche Patienten suchen mich mit Krankheiten wie einer kaputten Niere auf, die ihren Ursprung oft noch im jeweiligen Herkunftsland haben. In Deutschland gibt es viel bessere Behandlungsmöglichkeiten, allein schon durch die hochwertigere Ausstattung. Es kommt aber vor, dass mich die Asylbewerber-Aufnahmestelle bittet, dass diese Patienten nicht in einem Trierer Krankenhaus operiert werden, weil in ihrem Gebäude die Bedingungen für eine postoperative Behandlung nicht optimal sind. Dann schicken wir die Kranken nach Ludwigshafen, wo es dafür bessere Möglichkeiten gibt. Insgesamt haben die psychosomatischen Probleme der Flüchtlinge in den letzten Jahren zugenommen.
War diese Entwicklung ein Motiv für Ihr Engagement im Beirat für Migration und Integration?
Ja. Dadurch kann ich meine vielfältigen Kontakte und Erfahrungen nutzen und im Kleinen einiges bewirken. In den Gesprächen mit der Aufnahmeeinrichtung werden meine Empfehlungen oft respektiert und so weit wie möglich ausgeführt. Ich habe als Beiratsmitglied in der Arbeitsgruppe Gesundheit an der Erstellung des Integrationskonzepts mitgewirkt. Aufklärung, Vorsorge und Prävention, zum Beispiel durch Sport, sind mir insgesamt besonders wichtig.
Wie stellt sich die gesundheitliche Situation von Migranten der zweiten und dritten Generation nach Ihrer Einschätzung dar?
Auch hier gibt es eine Häufung psychosomatischer Erkrankungen. Identitätskonflikte in einem Leben zwischen dem Heimatland und dem Alltag in Deutschland gibt es vor allem bei Migranten aus Nahost-Staaten und der ehemaligen Sowjetunion. Sie trauen oft nicht den Diagnosen deutscher Ärzte, nur weil die Behandlung anscheinend nichts kostet und sie lieber dem Arzt aus der alten Heimat vertrauen. Anders verhält es sich bei Patienten aus weiteren Staaten Osteuropas, wie Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen oder Tschechien. Sie sind oft sehr dankbar, überhaupt zum Arzt gehen zu können und wissen das deutsche Gesundheitssystem sehr zu schätzen. Patienten aus anderen EU-Staaten sind ebenfalls meist sehr unkompliziert.
Gibt es Probleme oder Hürden bei der Untersuchung und Behandlung von Frauen, die zum Beispiel mit religiösen Vorstellungen im Islam zusammenhängen?
Das kommt sehr, sehr selten vor, weil den Frauen vorher die Grundlagen erklärt wurden, wie sie sich beim Arzt verhalten müssen. Manchmal kommt auch eine Begleitung zum Arztgespräch mit, aber nicht zur Untersuchung selbst. Ich habe es in meiner beruflichen Praxis nur einmal vor 25 Jahren erlebt, dass auf Intervention des Vaters die Behandlung eines türkischen Mädchens abgebrochen wurde. Vermutlich ist der religiöse Fanatismus in Metropolen wie Berlin grö-ßer als in Trier. Ein Frau mit Burka habe ich in meiner Praxis noch nicht erlebt.
Das Gespräch führte Petra Lohse